Was ist ein Softwareentwickler?
Ein Softwareentwickler löst durch die Konzeptionierung, Entwicklung und Wartung von Programmcode reale Probleme. Dazu werden die Anforderungen und Verbesserungspotenziale aktueller Prozesse ermittelt und durch neue Software ergänzt. Das Aufgabengebiet eines Softwareentwicklers ist somit sehr groß. Je nach Rolle innerhalb eines Projektes können Softwareentwickler Aufgaben im Bereich der Programmierung, Anwendungsentwicklung oder des Software-Engineering ausüben. Der Arbeitsablauf lässt sich auf die fünf Prozessschritte Anforderungsmanagement, Entwicklung des Codes, Testing, Wartung und Behebung von Incidents eingrenzen. Ziel der Arbeit ist es, Softwareprogramme zu verbessern oder neu zu entwickeln.
Eine Unterscheidung zwischen Softwareentwicklern kann anhand des Softwarestacks erfolgen, auf welches sie ausgebildet sind. So können Softwareentwickler unter anderem im Frontend- oder im Backend entwickeln. Experten mit dem Titel "Full Stack Developer" beherrschen alle Stacks und sind somit Generalisten.
Der Beruf kann sowohl als Freelancer oder in Festanstellung ausgeübt werden. Die Arbeit innerhalb eines Teams ist in beiden Fällen oftmals gegeben.
Aufgaben als Softwareentwickler
Der Glaube, dass Softwareentwickler lediglich Code entwickeln, ist weit gefehlt. Meist sind sie von der Idee bis hin zur finalen Umsetzung von Programmen eingebunden. Das Aufgabenfeld ist dabei nicht genau definiert. Auch hinsichtlich der Programmiersprachen oder der Betriebssysteme gibt es weitreichende Unterschiede, weshalb Spezialisierungen auf einzelne Softwarestacks üblich sind.
Alle Aufgaben lassen sich in folgende fünf Bereiche gliedern:

Anforderungsmanagement

Entwicklung des Quellcodes
Ist das Vorgehen definiert, wird die Software-Architektur mithilfe verschiedener Programmiersprachen umgesetzt. Die am häufigsten genutzten Programmiersprachen sind hierbei Java, C++ oder PHP, wobei auch Cobol und Perl weit verbreitet sind.
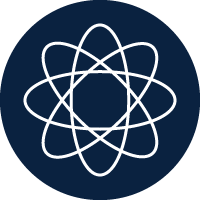
Testing
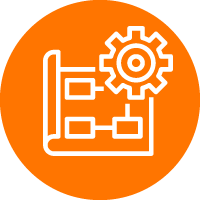
Implementierung der Software
Sobald die Implementierung und Installation abgeschlossen sind, werden die Stakeholder von dem Softwareentwickler hinsichtlich aller Funktionalitäten eingewiesen.
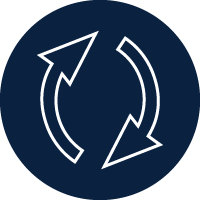
Wartung und Behebung von Incidents
Programmiersprachen
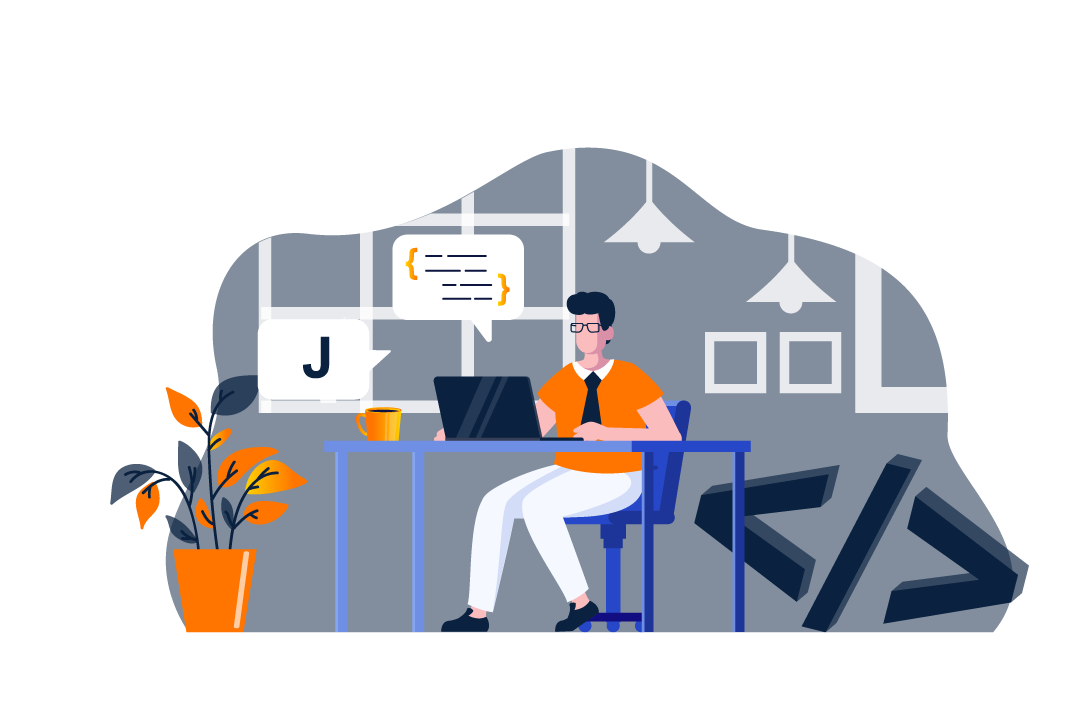
JAVA
Die Java-Technologie lässt sich in drei verschiedene Elemente gliedern, die Programmiersprache Java, das Java Developer Kit (JDK) und die Java-Laufzeitumgebung.
C++
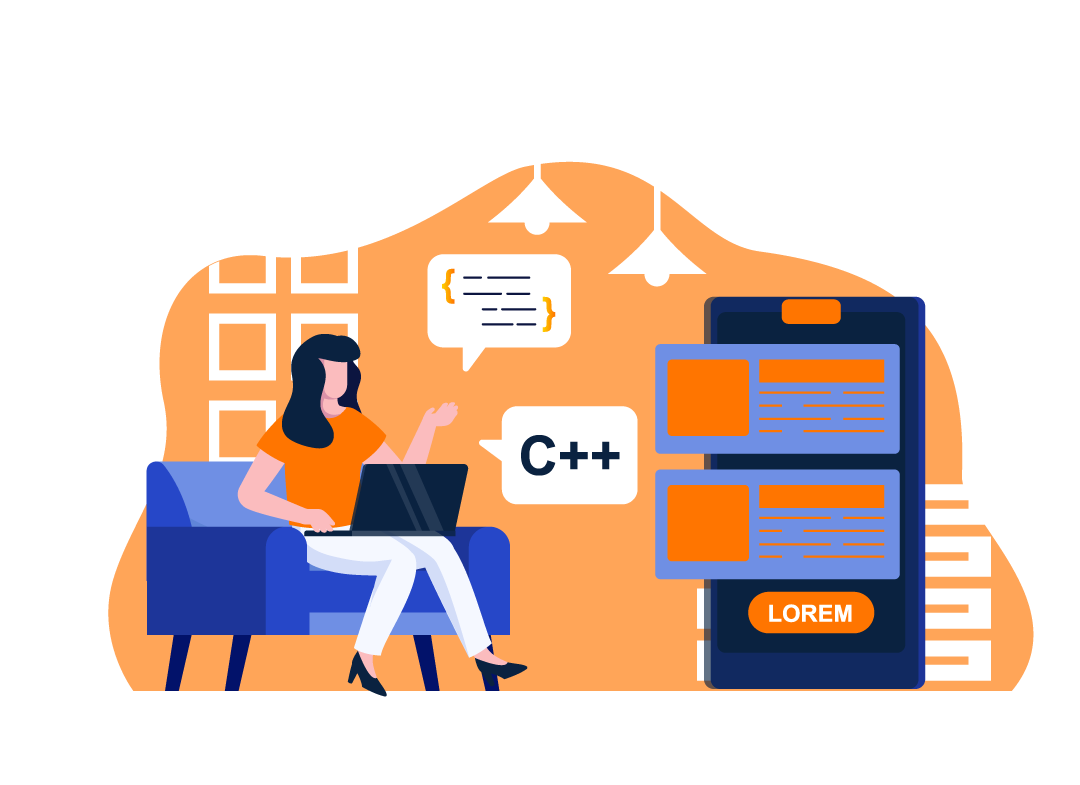
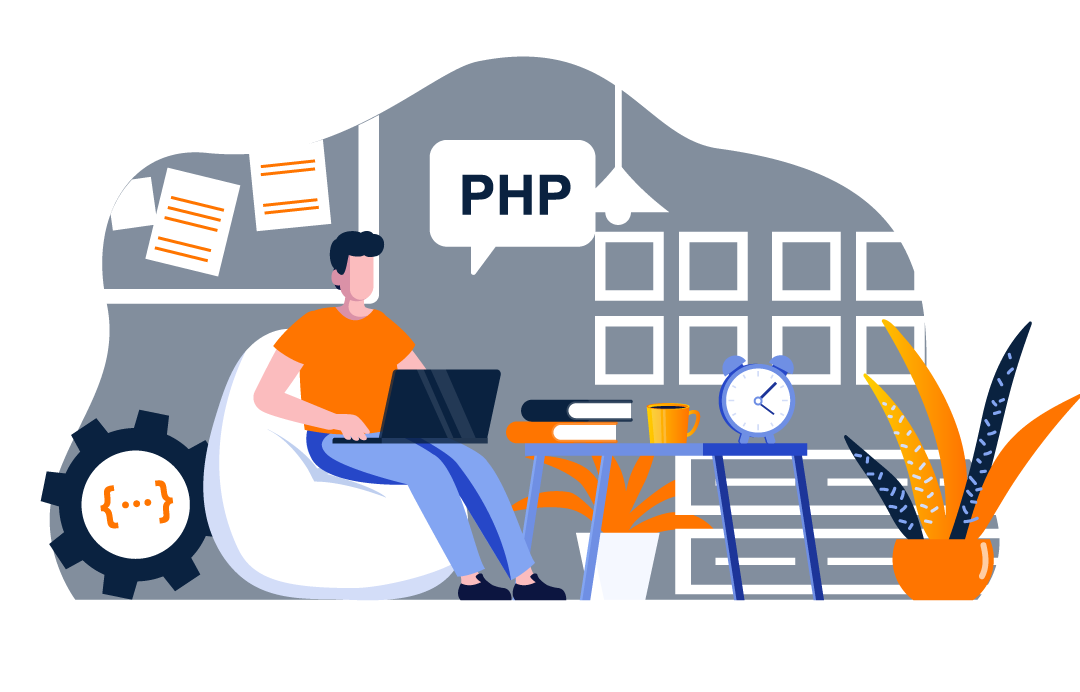
PHP
COBOL
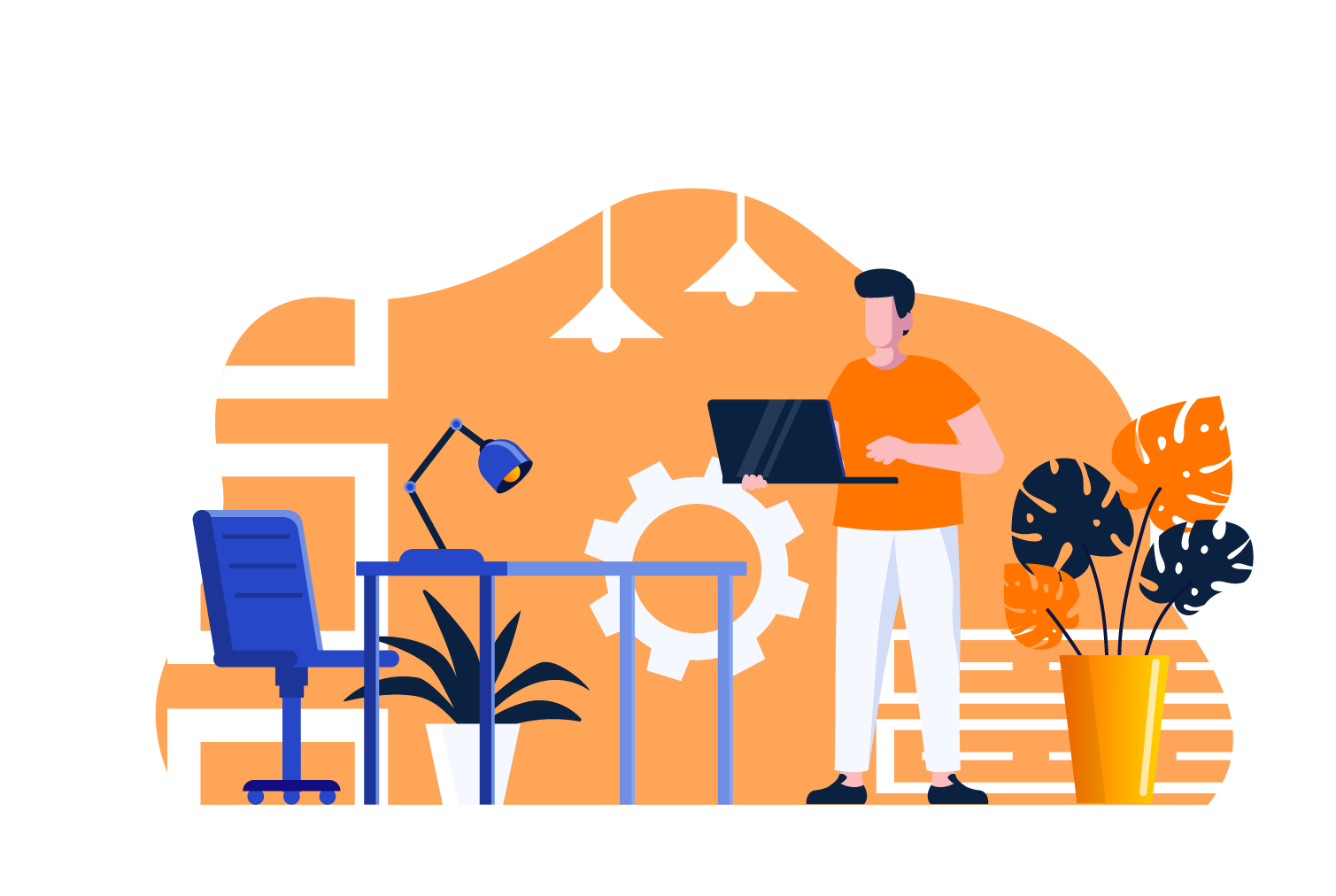
Gehalt: Wie viel verdient ein Softwareentwickler?
Als Softwareentwickler liegt das Einstiegsgehalt zwischen 38.000 Euro und 45.000 Euro pro Jahr. Mit anwachsender Erfahrung, zunehmender Verantwortung sowie der Übernahme von Führungstätigkeiten kann es auf bis zu 86.000 Euro jährlich steigen. Die Spanne ist somit sehr groß und der tatsächliche Lohn kann durch die ausgeübte Tätigkeit, die Projektverantwortung oder auch durch eine sehr spezialisierte Tätigkeit stark variieren. Entscheidend für die Höhe des Gehaltes sind zudem der Abschluss (Ausbildung, Bachelor oder Master) sowie äußere Faktoren wie der Standort des Unternehmens und die Unternehmensgröße. Je höher der Abschluss, desto mehr wird tendenziell verdient. So verdient ein Masterabsolvent oftmals mehr als ein Softwareentwickler mit einem Bachelor.
In Bundesländern wie Hessen, Bayern und Baden-Württemberg ist das durchschnittliche Gehalt tendenziell höher. In Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt hingegen liegt das Gehalt eher unter dem Durchschnitt. Je größer das Unternehmen, desto höher sind die Gehälter. Softwareentwickler in Unternehmen mit 1-50 Mitarbeitern verdienen weniger als in Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern.
FAQ
Aktuelle Jobs und Projekte für Softwareentwickler
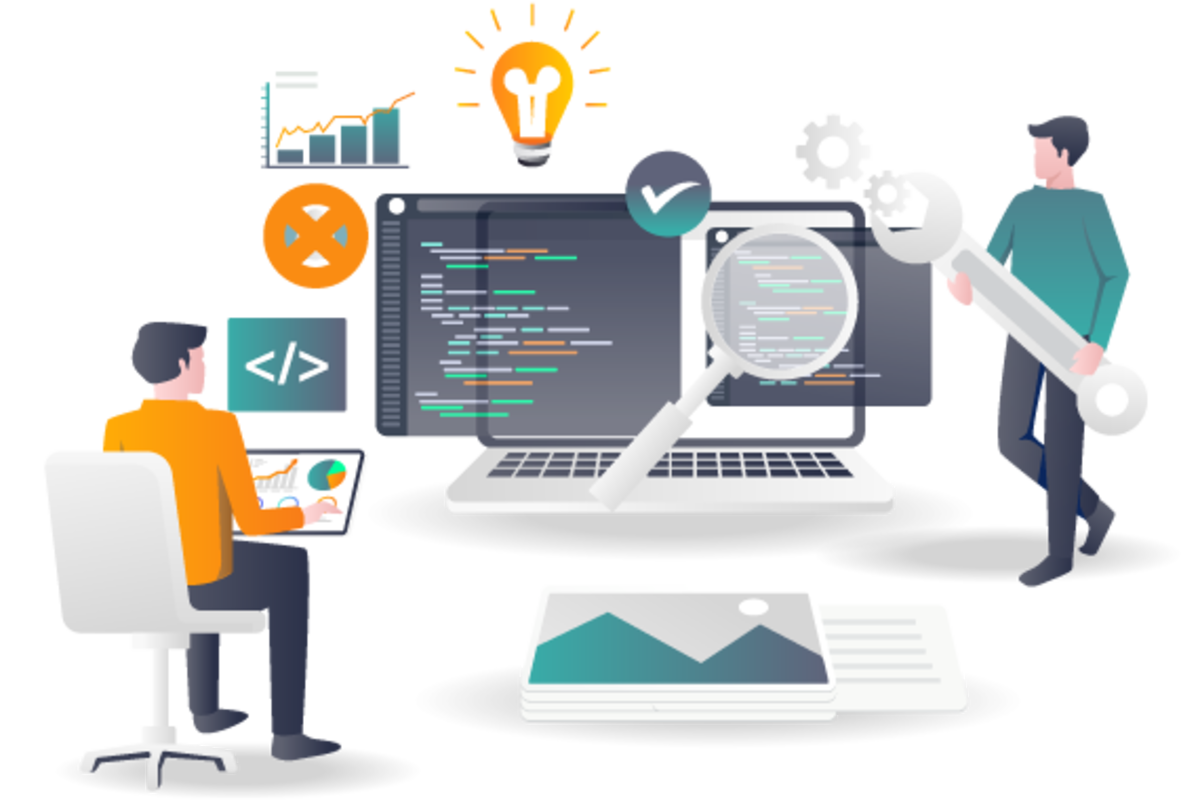
- Softwareentwickler VB6 / Cobol (m/w/d)
- Embedded Softwareentwickler (m/w/d)
- Softwareentwickler GIS (m/w/d)
- Softwareentwickler Mobile Device Management / Jamf (m/w/d)
- Fullstack-Softwareentwickler (m/w/d)
- Softwareentwickler QT (m/w/d)
- Softwareentwickler Atlassian (m/w/d)
- Softwareentwickler MS Dynamics 365 Customer Insights & Sales (m/w/d)
- Softwareentwickler Angular (m/w/d)
- Softwareentwickler Geoinformationssysteme (m/w/d)
- Softwareentwickler (m/w/d)
- Fullstack-Softwareentwickler (m/w/d)
- Softwareentwickler COBOL (m/w/d)
- Softwareentwickler C# / C++ (m/w/d)
- Softwareentwickler KI / UX (m/w/d)
























